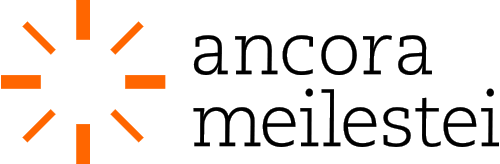Manhattan- oder Michelangelo-Effekt?
Sandra fragt sich, wie es für sie nach der Schule weitergehen soll. Sie hat sehr gute Noten, könnte studieren. Die junge Frau interessiert sich für Psychologie. Ganz sicher ist sie jedoch nicht, also sucht die Christin das Gespräch mit Leuten aus ihrer Gemeinde. Dort raten ihr viele ab, haben Bedenken wegen des Studienfachs oder ermutigen Sandra einfach, eine Ausbildung in der Nähe zu beginnen. Sie hört auf diesen Rat und beginnt eine Ausbildung als Krankenschwester im Kreiskrankenhaus.
So kann sie weiterhin ihre Gemeinde besuchen, den Teenkreis leiten, sich im Musikteam einbringen und verstärkt schlicht die «junge Fraktion» ihrer Kirchengemeinde. Erst im Laufe der Zeit wird ihr bewusst, dass die guten Ratschläge eher dem Erhalt dieser Situation galten als ihr selbst. Sie ist frustriert und fühlt sich ausgebremst. Ein Einzelfall? Leider nicht.
Beim Umgang von einzelnen Menschen miteinander wird ein Verhalten, das das Gegenüber bremst, als Manhattan-Effekt bezeichnet. Das Gegenstück dazu ist der Michelangelo-Effekt. Sie beziehen sich zwar nicht direkt auf das Zusammenleben in einer Gruppe wie der Gemeinde, aber sehr vieles lässt sich darauf anwenden.
Der Manhattan-Effekt
Isaac hat sich in die wesentlich jüngere Tracy verliebt. Als sie die Möglichkeit erhält, für ein Semester im Ausland zu studieren, will er sie unbedingt überreden zu bleiben und stellt damit seine Gefühle für sie über die Chancen, die seine Geliebte gewinnen würde. Diese Handlung entstammt dem Woody-Allan-Film «Manhattan» und gab dem Effekt seinen Namen. «Forscherinnen und Forscher nutzten den Titel des Films, um ein Phänomen zu beschreiben, bei dem Menschen ihre Partner bis zu einem gewissen Grad unterstützen, aber auch Einfluss auf deren Entscheidungen nehmen, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse in der Beziehung gefährdet sehen», erklärt Luise Rau den Effekt näher.
Dabei geht es in der Praxis nicht nur darum, dem Gegenüber etwas auszureden, sondern auch durch fehlende Unterstützung und Ermutigung Einfluss zu nehmen. Das Motiv dahinter ist in erster Linie Angst, dass eine mögliche Veränderung der Beziehung schaden oder sonstige negative Auswirkungen haben könnte. Das Paradoxe ist, dass genau dieser scheinbare Schutz der Beziehung sie oft zerstört – «teilweise mehr, als wenn man die andere Person in ihren Plänen unterstützen würde», meint Rau. In Kirche und Gemeinde bildet sich der Manhattan-Effekt oft in der oben bereits beschriebenen Art ab. Wenn immer weniger junge Leute in der Gemeinde sind, tut es einfach gut, wenn einige bleiben. Ausserdem hätte man ja jahrelang «umsonst» in sie investiert.
Heraus aus dem Manhattan-Effekt
- Der erste Schritt, um den Effekt zu vermeiden, ist es, sich bewusst zu machen, dass auch die eigenen Ratschläge und Entscheidungen in der Gemeinde von Ängsten oder Egoismus geleitet sein können. Hier hilft es, den Manhattan-Effekt überhaupt zu kennen und wahrzunehmen.
- Danach ist es sinnvoll, sich über die eigenen Emotionen klarzuwerden und sie auch offen zu kommunizieren: «Es macht mir Sorgen, dass so viele junge Leute gehen…»
- Schliesslich hilft es, sich die Konsequenzen des eigenen Handelns (Unterstützung oder fehlende Unterstützung) vor Augen zu führen. Oft geht es tatsächlich um Fragen wie das Glück oder die Lebensberufung beim anderen.
Der Michelangelo-Effekt
Die Legende besagt, dass Michelangelo seinen «David» aus einem als unbrauchbar zur Seite gestellten Marmorblock erschuf, indem er einfach die darin versteckte Figur herausholte, wie er selbst betonte. Im nach ihm benannten Effekt geht es darum, «dass Partner sich in einer Beziehung gegenseitig beeinflussen, formen und gestalten – so wie einst Michelangelo in der Renaissance seine Skulpturen formte». So fasst Lena Kirchner das Phänomen zusammen, das 1999 zuerst von US-Psychologen beschrieben wurde, die feststellten, «dass sowohl alleine als auch in einer Partnerschaft das Erreichen des idealen Selbst das unterbewusste Ziel einer Person ist». Sprich: Wer andere unterstützt, hilft ihnen dabei, ihr Potenzial zu entfalten und zu der Person zu werden, die sie sein könnten.
Ein typisches biblisches Beispiel für den Michelangelo-Effekt in der Gemeinde ist der neutestamentliche Barnabas (vgl. hier bei Livenet). Er ermutigte andere, investierte sich in sie und liess dabei sogar zu, dass sie ihn in Einfluss und Möglichkeiten überflügelten – menschlich gesprochen hätte es den bekannten Apostel Paulus ohne Barnabas so nicht gegeben.
Hinein in den Michelangelo-Effekt
- Die wichtigste Grundlage, um diesen Effekt zu stärken, ist es, sich die Wirksamkeit der eigenen Ermutigung immer wieder vor Augen zu stellen.
- Dazu gehören: positive Rückmeldungen, konstruktive Kritik, eine grundsätzliche Annahme des anderen, eine Fehlerkultur, die Versagen und Weitergehen möglich macht.
- Das kann immer wieder heissen, sich andere in der Gemeinde so vorzustellen: «Was mag Gott wohl mit dir vorhaben? Und wie kann ich dich dabei unterstützen, zu diesem Menschen zu werden?» Konkret hat man vielleicht ein «dickköpfiges» und anstrengendes Kind im Kindergottesdienst. Ein paar Jahre später ist man dagegen froh, wenn man eine durchsetzungsstarke, gereifte Persönlichkeit in der Gemeindeleitung hat. – Eine langfristige Perspektive hilft hier weiter.
Zum Thema:
Heinz Strupler: «Keine Alternative für eine Beziehung mit Jesus»
Frei von Sucht und Ehebruch: Ehe – ein Geschenk für Mann und Frau
Frage-Plattform rund um Liebe: «Wie weiss ich, dass jemand in mich verliebt ist?»