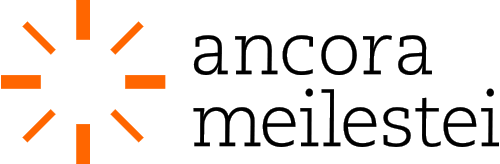Glaube und Naturwissenschaften vertragen sich prächtig
Die Existenz bereits grosser Galaxien zu einer Zeit, in der das Universum dafür noch zu jung sein sollte, stellt die Urknalltheorie in Frage. Nach dieser Theorie ist das Universum vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entstanden. Raum, Zeit und Materie bildeten sich dabei aus einer Singularität, von der aus sich der Raum seither kontinuierlich ausdehnt. Kritiker bezeichneten diese Idee anfangs verächtlich als «Big Bang». Heute gilt die Urknalltheorie als Standardmodell der Kosmologie.
Manche Christen tun sich schwer mit dieser Urknalltheorie. Sie scheint nicht mit dem Schöpfungsbericht in 1. Mose Kapitel 1 vereinbar zu sein. Zudem sind Zeiträume von Milliarden Jahren nach menschlichen Massstäben unvorstellbar. Da kommen Forschungsergebnisse, die diese Theorie in Frage stellen, vielleicht gerade recht. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass der Begründer der Urknall-Theorie Christ war.
Der Vater der Urknall-Theorie ...
Georges Lemaître (1894-1966) ist der «Vater» der Urknalltheorie. Er war Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker in einer Person. Bereits im Alter von neun Jahren war für ihn klar, dass er sowohl Priester als auch Naturwissenschaftler werden wollte. In einem Zeitungsartikel erklärte Lemaître später: «Es gibt zwei Wege, zur Wahrheit zu gelangen. Ich entschloss mich, beiden zu folgen.» Dieser Überzeugung blieb er sein Leben lang treu. Glaube und Naturwissenschaft waren für ihn keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Seine Überzeugung vom Verhältnis und Zusammenwirken von Theologie und Naturwissenschaft kommt in einem Vortrag von 1936 zum Ausdruck. Einige seiner gehaltvollen Impulse möchte ich hier weitergeben.
... und einige seiner Gedanken zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube
Viele Gläubige entfremden sich von der Kirche, weil sie den Eindruck haben, dass die Kirche die Suche nach der natürlichen Wahrheit verachtet und dass es ihrer Lehre an Begeisterung für die Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften mangelt.
Es ist wichtig, die Schönheit der wissenschaftlichen Ergebnisse der Mathematik, der Physik, der Botanik usw. voll zur Geltung zu bringen. Dies ist ein wesentliches Element des Humanismus, dem unsere Schulen verpflichtet sind. Beim Aufzeigen der gegenwärtigen Grenzen der Naturwissenschaften muss sorgfältig darauf geachtet werden, Misstrauen und Verachtung zu vermeiden. Die notwendige Kritik muss gemildert werden durch die Hoffnung auf den zu erwartenden Fortschritt der Wissenschaft, der unseren Erkenntnishorizont erweitern wird. So wie er es in der Vergangenheit immer wieder getan hat.
Die Theologen sind zum Teil selbst für das Missverständnis zwischen Wissenschaft und Glauben verantwortlich. Wenn ein scheinbarer Konflikt entsteht zwischen einer traditionellen religiösen Lehre und einer neuen Hypothese, die durch Fakten nach und nach bestätigt wird, neigen Theologen zu sehr dazu, so lange auszuharren, bis die Hypothese beinahe endgültig bewiesen ist. Sie sollten stattdessen sorgfältig diejenigen Punkte der Lehre studieren, die den Konflikt zu provozieren scheinen, und sich bemühen, unter der Leitung der zuständigen Autorität genau herauszuarbeiten, was der unzweifelhafte Gehalt der Offenbarung ist. Auf jeden Fall würde eine solche kluge Höflichkeit in wissenschaftlichen Kreisen sehr geschätzt werden und sich als ausgezeichnete Apologetik erweisen.
Schliesslich und vor allem müssen wir uns besonders davor hüten, in die Falle von zweit- und drittklassigen Populärwissenschaftlern zu tappen, die die Religion im Namen dessen angreifen, was sie glauben, von der Wissenschaft verstanden zu haben. Diese Leute sind in Wirklichkeit Provokateure, die Erfolg hätten, wenn wir sie als anerkannte Vertreter der Wissenschaft behandeln und ihnen mit Verachtung oder Feindseligkeit begegnen würden.
Wie soll der christliche Forscher seine religiösen Überzeugungen mit den technischen Anforderungen des von ihm gewählten wissenschaftlichen Fachgebiets in Einklang bringen? Es scheint, dass er – wie so oft – den Mittelweg zwischen zwei Extremen gehen sollte. Das eine Extrem betrachtet diese Bereiche als zwei völlig unabhängige Abteilungen aus denen er, je nach Umständen, entweder seine Wissenschaft oder seinen Glauben hervorholt. Das andere Extrem vermischt und verwechselt unbedacht und respektlos, was getrennt bleiben sollte.
Der christliche Forscher sollte die richtige Technik für sein Problem beherrschen und klug anwenden. Seine Methoden sind die gleichen wie die seines nichtgläubigen Kollegen. Das gilt für die Freiheit seines Denkens, aber nur, wenn seine Vorstellung von religiösen Wahrheiten mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung übereinstimmt. Er weiss, dass alles von Gott geschaffen wurde. Er weiss aber auch, dass Gott nirgendwo den Platz eines seiner Geschöpfe einnimmt. Gottes allgegenwärtiges Wirken ist im Wesentlichen verborgen. Es kommt nicht in Frage, das höchste Wesen auf die Ebene einer wissenschaftlichen Hypothese zu reduzieren. Die göttliche Offenbarung hat uns nie gelehrt, was wir selbst hätten entdecken können, jedenfalls dann nicht, wenn diese natürlichen Wahrheiten nicht notwendig sind, um die übernatürliche Wahrheit zu verstehen. Der christliche Forscher kann also frei vorgehen in der Gewissheit, dass es keinen wirklichen Konflikt zwischen seiner Forschung und seinem Glauben geben wird.
In gewisser Weise lässt der Forscher seinen Glauben bei seiner Forschung beiseite, nicht weil er ihn behindern würde, sondern weil er für seine Forschungstätigkeit keine unmittelbare Relevanz hat. So geht, läuft oder schwimmt ein Christ ja auch nicht anders als ein Nicht-Christ.
Aber der christliche Forscher weiss, dass sein Glaube sowohl der höchsten als auch der niedrigsten seiner Tätigkeiten eine übernatürliche Dimension verleiht! Er bleibt ein Kind Gottes, wenn er durch sein Mikroskop blickt, und in seinem Morgengebet stellt er sein Tageswerk unter den Schutz seines himmlischen Vaters. Wenn er über die Wahrheiten des Glaubens nachdenkt, erkennt er, dass sein Wissen über Mikroben, Atome oder Sterne ihm niemals helfen oder ihn daran hindern wird, dem unzugänglichen Licht zu folgen. Und dass er, wie jeder Mensch, das Herz eines Kindes erlangen muss, um ins Himmelreich zu gelangen.
So verbinden sich Glaube und Vernunft im menschlichen Handeln, ohne dass es zu einer unangemessenen Vermischung oder zu einem vermeintlichen Konflikt kommt.
Eine faszinierende Verbindung
Mich faszinieren Menschen wie Lemaître. Ihr Glaube an Gott ist nicht Hindernis, sondern Grund und Motivation für ihre naturwissenschaftliche Forschung. Wer verstanden hat, dass die Frage nach Gott, dem Schöpfer und die Frage nach der Funktionsweise seiner Schöpfung auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind, braucht keine Angst vor neuen naturwissenschaftlichen Theorien zu haben. Sie dienen nur dazu, das wunderbare Werk Gottes zu verstehen. Ich freue mich deshalb jetzt schon auf die nächsten Bilder, die uns das James Webb Space Telescope übermitteln wird.
Zum Thema:
Vom Christen zum Atheisten: Wenn man nicht mehr glauben kann
Jesus und die Auffahrt: Wo sind «die Himmel»?
Buch von Alex Stebler: Darf die Evolutionstheorie hinterfragt werden?