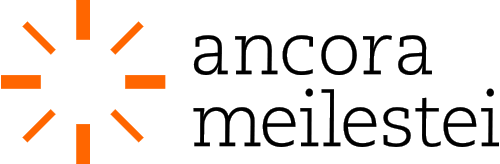«Letzte Hilfe» lässt sich lernen
«Wir sind eine Lerngemeinschaft», sagt Frank Sachweh. «Sicherheit gibt es nicht, nur geteilte Unsicherheit.» Der Pfarrer aus Sulgen ist einer der vier Thurgauer Kursleiter der «Letzten Hilfe». Jeweils als Tandem aus einem Seelsorge-Experten und einer Pflegefachfrau besprechen sie mit den Teilnehmenden alle Fragen, die in Zusammenhang mit einer Sterbebegleitung auftauchen können.
Einiges ist klar zu beantworten. Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgeaufträge, Beerdigung, Bankkonten oder Steuern werden angeschnitten. Auch das Deuten von Symptomen und das Lindern von Beschwerden lassen sich sachlich vermitteln. Doch wie integriert man das Sterben als selbstverständlichen Teil in das Leben? Wie nimmt man Abschied? Das sind Fragen, für die gemeinsam nach möglichen Antworten gesucht wird.
Wissen ist verloren gegangen
Den Kurs besuchen meist Angehörige von Schwerkranken. «Es kommen genauso Freiwillige aus den Begleitdiensten von Spitälern und Kirchen», sagt Kursleiterin Marina Bruggmann-Widmer, im Hauptberuf Geschäftsführerin des Hospizdienstes Thurgau. «Und auch Ältere waren schon dabei, die wissen wollen, was auf sie zukommt.» Sich der eigenen Endlichkeit zu stellen, ist nicht selbstverständlich. «Die Gesellschaft hat die Begleitung von Sterbenden heute delegiert», sagt Frank Sachweh. «Es ist viel Wissen verloren gegangen, seit die Alten und Kranken im Spital oder im Altersheim sterben. Doch man muss die Begleitung nicht Fachleuten überlassen. Jeder kann trösten, jeder kann zuhören.» Martina Bruggmann meint ebenfalls: «Früher gehörte das Sterben in den Familienalltag. Kinder sahen, wie ihre Grosseltern am Ende des Lebens umsorgt wurden, und lernten.»
Da sein hilft schon viel
Naturgemäss würde man sich am Sterbebett hilflos fühlen, so die Palliativ-Expertin, aber man könne eben doch etwas tun. «Ich erkläre beispielsweise die Mundpflege, aber auch, wie man den Menschen berührt, wie man ihn begrüsst, wenn er sich nicht mehr äussert, oder welche Rituale die letzte Lebensphase begleiten können. Vielleicht freut den Sterbenden Musik oder ein Geschmack auf der Zunge.» Die physischen Anzeichen des nahenden Todes sind ebenfalls Thema des eintägigen Kurses. Manches sei für die Angehörigen schwer auszuhalten. «Sterbende können ängstlich werden. Das Wichtigste ist es, für den Menschen da zu sein. Unruhe gehört sehr oft zum Weg dazu.»
Selbstfürsorge nicht vergessen
Die Kursleiter legen besonderen Wert darauf, dass die Begleiter ihre eigenen Kräfte einteilen. «Sie müssen rechtzeitig Unterstützung suchen und sich Auszeiten nehmen», sagt Bruggmann. Ein Innehalten müsse es auch nach dem Tod eines Angehörigen geben. «Das Trauerjahr, das man früher befolgte, war sinnvoll. Niemand erwartete, dass man sofort wieder funktioniert.» Jetzt appelliert sie an Hinterbliebene, sich wenigstens unmittelbar nach dem Tod eine Pause zu gönnen. «Dann pressiert nichts mehr. Ja, man muss den Arzt rufen und es der Gemeinde melden, aber vor allem muss man Abschied nehmen.»
Kirchgemeinden ideale Ansprechpartner
Die meisten der Kurse, die «Letzte-Hilfe»-Tandems bisher gegeben haben, hatten Kirchgemeinden organisiert. Pfarrer Sachweh findet das richtig: «Die Kirchen haben heute mitunter einen schweren Stand, aber im diakonischen Bereich ist Kirche gesellschaftlich relevant. Wir sind gut im Vernetzen – das können wir hier gut gebrauchen.» Die Begleitung von Sterbenden gehe zwar alle an. «Aber wir fangen gerne in den Kirchgemeinden an, weil wir dort auf Menschen treffen, die gewohnt sind, sich um andere zu kümmern. Der Nährboden ist gut.»
Weitere Informationen zum Kurs «Letzte-Hilfe» finden sich hier. Der Kurs wird auch von anderen Landeskirchen sowie online angeboten.
Zum Thema:
Über Einheit und Klarheit: Keine Palliativ Care in den Kirchen
Livenet-Präsidentin Marianne Streiff: «Das Wohl der Menschen soll im Zentrum stehen»
Was ist Hoffnung?: Der Tod hat nicht das letzte Wort